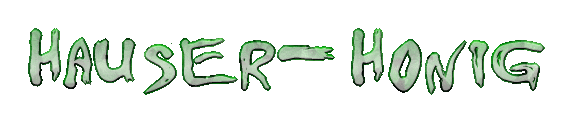
|
www.honigtreff.de |
|
|
Copyright © by Dr. Thomas Hauser |
Hausers kleine Honigkunde -Wissenswertes über echten deutschen Honig-
bitte klicken Sie auf die Bilder um sie zu vergrößern
Ausgewählte Inhaltsstoffe
was man sonst noch über Honig wissen sollte:
Honig ist ein von Honigbienen zur eigenen Nahrungsvorsorge aus dem Nektar von Blüten oder Honigtau erzeugtes Lebensmittel. Er besteht aus etwa 200 verschiedenen Inhaltsstoffen. Die Zusammensetzung kann je nach Honigsorte sehr unterschiedlich sein. Die mengenmäßig wichtigsten Inhaltsstoffe sind Fruchtzucker (27 bis 44 %), Traubenzucker (22 bis 41 %) und Wasser (ca. 18 %). Weitere typische Inhaltsstoffe sind andere Zuckerarten, Pollen, Mineralstoffe, Proteine, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine, Farb- und Aromastoffe. Honig kann flüssig oder auch fest (kandiert) sein. Dies hängt hauptsächlich von dem Verhältnis der beiden Einfachzucker Frucht- und Traubenzucker zueinander ab, aber auch davon, wie der Honig weiter verarbeitet und gelagert wird. Honig wird seit der Steinzeit durch den Menschen genutzt und war lange Zeit das einzige Süßungsmittel. Durch die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von billigem Haushaltszucker (reine Saccharose) aus Zuckerrüben und Zuckerrohr ist Honig in dieser Hinsicht weitgehend verdrängt worden. Vor allem spielt er in der modernen, weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie fast keine Rolle. Trotzdem wird Honig als Nahrungsmittel, zum Beispiel als süßer Brotaufstrich, oder als Alternative zum denaturierten Haushaltszucker weiterhin geschätzt. Der Pro-Kopf-Jahres-Verbrauch liegt in Deutschland bei etwa 1,4 kg. Große Mengen für den Weltmarkt werden in China und Nordamerika produziert. In neuerer Zeit wird ein speziell vorverarbeiteter, keimfrei gemachter Honig (siehe Medizinischer Honig) auch zur Wundversorgung, sogar im klinischen Bereich, eingesetzt. Hierdurch konnte die konventionelle Methode, die Verwendung von Antibiotika, ersetzt und die Heilwirkung teilweise sogar verbessert werden. NameDas deutsche Wort Honig stammt von einem alten indogermanischen Begriff ab, der ihn der Farbe nach als den „Goldfarbenen“ bezeichnet. Im Althochdeutschen hieß er honag nebst Varianten. In den germanischen Sprachen gibt es verwandte Namen, zum Beispiel englisch honey, schwedisch honung, dänisch honning oder niederländisch honing. In anderen indogermanischen Sprachen finden sich die Entsprechungen zweier anderer Namen. Das ist einerseits Sanskrit madhu „Honig“, „Met“, litauisch medus „Honig“, tocharisch B mit „Honig“. Daraus leitet sich auch die deutsche Bezeichnung Met für den Honigwein ab. Entstehung und ZusammensetzungHonig entsteht dadurch, dass Bienen Nektariensäfte oder auch andere süße Säfte an lebenden Pflanzen aufnehmen, durch körpereigene Stoffe bereichern, in ihrem Körper verändern, in Waben speichern und dort reifen lassen. Die Hauptquelle ist der Nektar von Blütenpflanzen, Ausdruck einer in Jahrmillionen durch die Evolution entstandenen gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Pflanzen und hauptsächlich Insekten zur effektiveren Bestäubung. Als weitere Quelle kommt in einigen, hauptsächlich gemäßigten Klimaregionen der Erde die gelegentliche Massenvermehrung verschiedener Rinden- und Schildläuse hinzu, bei der dann in ausreichenden Mengen Honigtau entsteht. Seltener spielen auch extraflorale Nektarien (keine Blüten) eine Rolle, zum Beispiel die Pflanzensaftabsonderung aus der Blattachsel beim Mais. Die Biene saugt den Nektar oder Honigtau über ihren Rüssel auf. In der Honigblase wird dieser in den Stock transportiert. Dort wird der zuckerhaltige Saft an die Stockbienen weitergegeben. Diese geben bieneneigene Stoffe hinzu und reduzieren den Wassergehalt. Die durch die Biene hinzugefügten Enzyme bewirken eine Veränderung des Zuckerspektrums und die Entstehung von Inhibinen - diese hemmen das Wachstum von Hefen und Bakterien. Die Reduzierung des Wassergehalts erfolgt in zwei Schritten: Zuerst wird ein Tropfen Nektar über den Rüssel mehrfach herausgelassen und wieder eingesaugt. Ab einem Wassergehalt von etwa 50 % wird der Nektar über dem Brutnest auf den Wabenzellen ausgebreitet. Durch kräftiges Fächeln mit den Flügeln und die dort herrschende Temperatur wird Wasser verdunstet, bis der Nektar einen Wassergehalt von etwa 16 bis 18 % erreicht. Nun werden die Lagerzellen des Honigs mit einer luftundurchlässigen Wachsschicht überzogen. Imker bezeichnen diesen Vorgang als Verdeckeln. Er ist für sie das sichere Zeichen dafür, dass der Honig reif ist und geerntet werden kann. Honig entsteht aber generell erst dann, wenn eine ausreichende Menge pro Zeiteinheit von den Sammelbienen in den Bienenstock heimgebracht wird. Diese muss über dem laufenden Eigenverbrauch, der zur Ernährung des Bienenvolks und zur Aufzucht der Brut notwendig ist, liegen. Der Imker spricht dann von einer Blüten- oder Honigtautracht. Es werden also nur Überschüsse zur Bevorratung weiterverarbeitet und schließlich eingedickt als Honig gelagert. Honig ist eine dickflüssige bis feste, teilweise auch kristallisierte Substanz, die aufgrund ihres hohen Anteils an Frucht- und Traubenzucker sehr süß schmeckt. Neben diesen und weiteren Zuckerarten (insgesamt 70 % Glucose und Fructose sowie 10 % Saccharose und Maltose) enthält Honig 15 bis 21 % Wasser (Heidehonig bis 23 %) sowie Enzyme, Vitamine, Aminosäuren, Pollen, Aromastoffe und Mineralstoffe. Durch diese Zusammensetzung gilt Honig für den menschlichen Gebrauch allgemein als gesünder als Haushaltszucker (Saccharose). Gemäß EU-Verordnung und deutscher Honigverordnung darf dem Honig nichts hinzugefügt und nichts entzogen werden. Damit ist der Honig zu 100 Prozent natürlich. Die Konsistenz (umgangssprachlich gebräuchlicher Begriff, korrekter wäre Viskosität) des Honigs reicht von dünnflüssig über cremig bis fest. Sie ist ebenso wie seine Farbe und sein Geschmack abhängig von den besammelten Blüten oder dem gesammelten Honigtau. Häufige Farben sind weiß bis hellgelb, gelb, beigefarben, braun und grünschwarz (siehe Honigsorten). Aufgrund seines hohen Zucker- und geringen Wassergehalts ist Honig lange haltbar, wobei er auskristallisieren kann. Für die Neigung zum Kristallisieren ist das Verhältnis von Frucht- zu Traubenzucker (der beiden Hauptbestandteile) verantwortlich. Ist dies etwa 1 : 1, wie etwa beim Rapshonig, so erfolgt die Kristallisation innerhalb weniger Tage. Bei den Honigtauhonigen, etwa dem Tannenhonig, ist das Verhältnis etwa 1,6 : 1. Dieser Honig bleibt über Monate oder sogar Jahre flüssig. Fest gewordener, auskristallisierter Honig kann durch Erwärmen wieder verflüssigt werden; Eine längere Lagerung bei hohen Temperaturen führt allerdings zu einer schnelleren Alterung und eine Erwärmung über 40 °C zerstört wichtige, ernährungsphysiologisch wertvolle Inhaltsstoffe. Der hohe Zucker- und der geringe Wassergehalt verhindern, dass sich Bakterien und andere Mikroorganismen (z. B. Hefen) vermehren können; sie werden osmotisch gehemmt. Die Dichte des Honigs beträgt etwa 1,4 kg/l.
Brennwert und InhaltsstoffeAlle Angaben der nachfolgenden großen Tabelle eines nicht näher bezeichneten, typischen Honigs beziehen sich auf eine Gesamtmenge von 100 g. Prozentangaben beziehen sich auf die Recommended Daily Allowance (RDA). Je nach Honigsorte treten folgende Zuckerarten (Kohlenhydrate) in unterschiedlicher Zusammensetzung auf:
Bedeutung für die BienenHonig dient dem Bienenvolk als Energiequelle, um längere Zeiten ohne Nahrung von außen zu überleben. So muss etwa im Winter eine Mindesttemperatur der so genannten Wintertraube von 10 °C gehalten werden, weil sonst die Bienen absterben. Die Strategie anderer staatenbildender Insekten (Wespen, Hornissen, Hummeln) besteht dagegen darin, dass das gesamte Volk zum Winter hin abstirbt und nur junge Königinnen in einer Kältestarre überleben. Diese Fähigkeit haben die Honigbienen nicht, dafür legen sie Honigvorräte an. Sie haben einen anderen Stoffwechsel, eine veränderte Zusammensetzung der Hämolymphe. Selbst bei tiefsten Temperaturen können die Bienen den Honig verwerten, da bei der Wärmeerzeugung, dem Verbrennen im Muskelgewebe, als Abbauprodukte Kohlendioxid und Wasser entstehen. Das Wasser reicht aus, um weiteren Honig zu verflüssigen, d. h. in einen nektarähnlichen, wieder verwendbaren Zustand zu bringen. Zusammengefasst liegt der Vorteil dieser Überlebensstrategie darin, als gesamtes Volk zu überleben und daher bessere Startbedingungen für einen Neubeginn (nach dem Winter) zu haben.
Nutzung durch den MenschenHonig gilt in Deutschland als Lebensmittel. Seit jeher kommt ihm in der Volksheilkunde eine große Bedeutung zu. Die Definition von Honig nach der EU-Norm lautet: Honig ist der natürliche Süßstoff, der von Honigbienen hergestellt wird aus Blütennektar oder Absonderungen lebender Pflanzenteile oder Ausscheidungen pflanzensaugender Insekten auf lebenden Pflanzenteilen, welche die Honigbienen sammeln, durch Vermischung mit spezifischen eigenen Substanzen verändern, ablagern, eindicken, lagern und in Honigwaben reifen lassen.
GeschichteSchon in der Steinzeit nutzte der Mensch Honig als Nahrungsmittel, wie es 9.000 Jahre alte steinzeitliche Höhlenmalereien mit „Honigjägern“ zeigen. Der wild lebenden Bienenvölkern abgenommene Honig wurde auch als Köder bei der Bärenjagd eingesetzt. Der Ursprung der Hausbienenhaltung mit geplanter Honiggewinnung wird im 7. Jahrtausend v. Chr. in Anatolien vermutet. Um 3.000 v. Chr. galt im Alten Ägypten Honig als „Speise der Götter“ und als Quelle der Unsterblichkeit: Ein Topf Honig wurde mit dem Wert eines Esels aufgewogen. Um 400 v. Chr. lehrte Hippokrates, dass Honigsalben Fieber senken und dass Honigwasser die Leistung der Athleten bei den antiken Olympischen Spielen verbesserte. GewinnungEine ausführliche Darstellung der Gewinnung und Verarbeitung von Honig findet sich im Artikel Imkerei. Die Ernte des Honigs für den menschlichen Gebrauch erfolgt durch Imker, welche die Bienenvölker hegen. In Europa erfolgte die Honigernte vom Mittelalter bis ins späte 19. Jahrhundert auch durch den konkurrierenden Beruf des Zeidlers. Entsprechend der Gewinnung des Honigs unterscheidet man folgende Sorten:
Aus der Wabe wird der Honig in einer speziellen Zentrifuge, einer so genannten „Honigschleuder“, bei Umgebungstemperatur gewonnen. Umstritten ist der Begriff des „kaltgeschleuderten“ Honigs, der in seiner Bedeutung nicht klar festgelegt ist. Ein Verfahren der Warmschleuderung gibt es nicht - jeder Schleuderhonig ist kaltgeschleudert, wenn man die Temperaturgrenze zwischen „warm“ und „kalt“ bei ca. 38 °C ansetzt. Das entspricht ungefähr der Maximaltemperatur im Honigraum eines Bienenvolkes. Trotzdem wird die Bezeichnung „kaltgeschleudert“ vor allem von den Honigimporteuren als besonderes Qualitätsmerkmal für Honig verwendet. Wichtiger für die Erhaltung der Inhaltsstoffe im Honig ist die kühle Lagerung. Deshalb darf gemäß der Deutschen Honigverordnung mit „Deutscher Honig“ gekennzeichneter Honig nicht über 40 °C erwärmt werden.
NahrungsmittelBereits in den Pharaonengräbern der alten Ägypter wurde Honig als Grabbeigabe gefunden. Bevor Zucker industriell aus Zuckerrüben gewonnen wurde, war Honig ein wichtiger, oft auch der einzige Süßstoff. Heute wird Honig als gesundes Nahrungsmittel verwendet. Der Pro-Kopf-Verbrauch beträgt in Deutschland etwa 1,3 kg pro Jahr. Honig sollte nicht über 40 °C erhitzt werden, wenn auf seine Enzyme und Aromastoffe Wert gelegt wird. Daher sollte man den Honig nicht kochen bzw. beim Kochen zugeben. Die kurzzeitige Erwärmung beim Süßen heißer oder warmer Getränke ist aber vertretbar, da das Getränk in der Tasse relativ schnell abkühlt.
HeilmittelNeben anderen Bienenprodukten wird Honig auch in der Naturheilkunde als Heilmittel eingesetzt, z. B. Manukahonig. Nach geltendem deutschen Recht darf für die Heilwirkung von Lebensmitteln nicht geworben werden und so darf Honig nicht als Heilmittel bezeichnet werden. Honig wirkt leicht entzündungshemmend, so dass Schwellungen, erhöhte Temperatur und lokaler Schmerz zurückgehen. Er fördert das Wachstum von Fibroblasten, wodurch die Wunde gleichmäßiger heilt und es zu weniger Narbenbildung kommt. Er wird etwa als Wundauflage benutzt, da er leicht antiseptisch wirkt und in Wunden vorhandenes totes Gewebe abbaut. Diese Wirkung wird durch Wasserstoffperoxid bewirkt, das im Honig durch den Abbau von Zucker entsteht und normalerweise im medizinischen Bereich zur Wunddesinfektion verwendet wird. Daneben werden in neuerer Zeit noch weitere Inhaltsstoffe (z. B. Inhibine) mit positiven Wirkungen erforscht, die unter anderem Methicillin-resistente Staphylokokken und Vancomycin-resistente Enterokokken abtöten. Spezielle Honigsorten finden daher zunehmend Eingang in die moderne Wundbehandlung. Naturbelassener Honig oder Honig „aus dem Glas“ eignet sich aufgrund einer möglichen Verkeimung jedoch nicht zur Wundbehandlung. Der für medizinische Zwecke angewandte Honig wird vor Anwendung mit Hilfe von Gammastrahlen sterilisiert. Im Gegensatz zur thermischen Sterilisation werden hierbei die an der Heilwirkung maßgeblich beteiligten Enzyme nicht zerstört. Bei Insektenstichen kann Honig, sofort aufgetragen, das Gift teilweise entziehen.
AllergienBlütenpollen sind, wenn auch in geringen Mengen, typische Bestandteile (ca. 0,5 %) des Honigs. Nach dem Verzehr von Honig kann es daher bei Pollenallergikern zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Vereinzelt wird jedoch berichtet, dass durch den Verzehr von Honig aus der eigenen Region eine Hyposensibilisierung erreicht wurde. Die regelmäßige Aufnahme von geringsten Mengen Blütenstaub über die Schleimhäute und den Verdauungstrakt führt dabei unter Umständen zu einer langsamen Gewöhnung des Körpers an diese Stoffe.
HonigsortenHonige verschiedener botanischer Herkunft unterscheiden sich nicht nur in Geschmack, Geruch und Farbe voneinander. Auch das Spektrum an Wirkstoffen ist für jede Nektar oder Honigtau erzeugende Pflanze typisch. Ist der Honig mit einer botanischen Herkunftsangabe versehen, so muss der Honig überwiegend, das heißt zu mehr als 50 %, der beschriebenen Quelle entstammen. Dies wird unter anderem über Geschmack, Pollengehalt (Melissopalynologie) und elektrische Leitfähigkeit bestimmt. Um solche typischen Honige zu gewinnen, ist es meist notwendig, die Bienenvölker zu entsprechenden Standorten zu transportieren, vgl. Wandern (Bienen).
Blütenhonige Blütenhonig wird der Honig aus dem Blütennektar von Pflanzen genannt - im Gegensatz zum Honig aus Honigtau (siehe weiter unten). Die meisten Blütenhonige kristallisieren nach ein bis sechs Wochen. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel Akazienhonig, der oft zwölf Monate flüssig bleibt. Durch intensives Rühren während der Kristallisationsphase kann der Zustand des Honigs beeinflusst werden. Dabei werden die sich bildenden Zuckerkristalle mechanisch zerkleinert und es entsteht ein feincremiger, weicher Honig. Man spricht hier auch von einer feinsteifen Konsistenz. Im Folgenden werden hauptsächlich die im deutschsprachigen Raum vorkommenden Sorten beschrieben. Dabei entspricht die Bezeichnung den Vorschriften für dieses Lebensmittel (Honigverordnung):
Honig aus HonigtauHonigtauhonig wird von Bienen erzeugt, welche die zuckerhaltigen und ballaststoffreichen Ausscheidungen von Pflanzenläusen, den Honigtau, sammeln. Dieser Honig hat meist eine deutlich dunklere Farbe als Honig aus Blütennektar und bleibt lange flüssig.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird oft nicht zwischen Wald- und Blatthonig unterschieden - beide Begriffe bezeichnen jeglichen Honig, der aus Honigtau entstanden ist.
Honig aus aller Welt
Medizinischer Honig (Medihoney)Dieser Honig stammt aus Neuseeland. Es handelt sich hierbei um ein
weiterverarbeitetes Produkt aus zwei getrennt entstandenen Honigsorten. Die
erste Komponente ist der Manukahonig mit seinen besonderen Inhaltsstoffen. Die
zweite Komponente ist ein normaler Blütenhonig mit einem hohen Anteil des
Enzyms Glucose-Oxidase.
Zudem ist dieses Gemisch durch Bestrahlung keimfrei gemacht worden. Dieser Honig
wird mit zum Teil spektakulären Erfolgen
auch im klinischen Bereich zur Wundbehandlung eingesetzt.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||